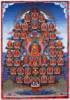Der Künstler
Um buddhistische Kunst herstellen zu können, müssen mehrere Bedingungen zusammenkommen. Der Künstler muss seine diesbezüglichen Fähigkeiten entwickelt haben, eine grundlegende handwerkliche Ausbildung bildet die Basis. Darüber hinaus ist jedoch das Wissen über die Maße und Proportionen (Ikonometrie) besonders wichtig. Weiterhin sind Erklärungen zur Beschreibung und Bedeutung der Buddhaaspekte (Ikonographie) notwendig. Diese grundlegenden Belehrungen muss der Künstler kennen und studiert haben. Die Meditation ist ebenfalls ein wesentlicher Punkt bei der Herstellung von Kunstwerken. So wird erzählt, dass wirkliche Meister auch durch Visionen oder Träume erfahren, wie sie bestimmte Themen darstellen sollen.

Statuen
Tibetische Bildhauer gossen ihre Statuen aus verschiedenen Metalllegierungen. Sie wurden meistens in einem äußerst aufwändigen Verfahren in verlorener Form gegossen, oft feuervergoldet und von Hand fein bemalt. Das Wachsausschmelzverfahren ist eine Gusstechnik zur Herstellung kleiner Bronzeplastiken mit Hilfe der so genannten „Verlorenen Form“. Das zu gießende Objekt wird zunächst aus Wachs geformt und mit Ton bedeckt, das heißt mit dem so genannten Formmantel. Danach wird der Ton durch Brennen gehärtet, wobei das Wachs durch die dafür angelegten Kanäle ausfließt und so den Hohlraum für das flüssige Metall freigibt. Die Form bringt man schließlich in ein Sandbett und gießt von oben das auf 800 – 900° C erhitzte Metall ein. Das in die Form gelangte flüssige Metall nimmt den durch das ausgeflossene Wachs freigewordenen Raum, das heißt exakt die Gestalt der ehemaligen Wachsplastik an. Um an das Gussstück zu gelangen, muss man die Formwand zerschlagen. Die Form ist somit verloren, das heißt nicht mehr verwendbar, daher auch der Ausdruck „Verlorene Form“. Der künstlerische Gesamteindruck der Statue hängt vor allem von der abschließenden Feinbearbeitung, dem Polieren, Gravieren, Bemalen und Einsetzen von kostbaren Metallen oder Steinen ab.

Thangkas
Aufgrund der Herstellungstechniken sind verschiedene Typen von Thangkas bekannt:
Die gemalten Thangkas (tib. bris thang) sind unterteilt in die Goldgrundthangkas (tib. gser thang) mit goldenem Hintergrund und meist zinnoberroten Umrisszeichnungen, sowie auch die Rotgrundthangkas, wo auf zinnoberrotem Hintergrund goldumrissene Figuren abgebildet werden. Hier sind hauptsächlich friedvolle Aspekte dargestellt. Die Schwarzgrundthangkas (tib. nag thang) sind ausschließlich für die kraftvoll schützenden Aspekte bestimmt und weisen einen schwarzen Hintergrund auf, der pechschwarz, aber auch bläulich schimmern kann. Die Umrisse der Schützer werden meist mit goldener Farbe gezeichnet.
Die ebenfalls sehr beliebten Seidenthangkas (tib. gos thang) unterteilen sich in die gestickten Thangkas (tib. tshen drub ma), die gestickten applizierten Thangkas (tib. l’han drub ma/dras drub ma) und die geklebten applizierten Thangkas (tib. l’han thabs ma).
Die gedruckten Thangkas (tib. dpar ma) werden mit einem Holzschnitt direkt auf einen Seidenstoff gedruckt. Die Umrisslinien sind entweder zinnoberrot oder tintenschwarz.
Traditionellerweise sind Thangkas in eine Stoffeinfassung eingenäht. Im Unterschied zu unserer westlichen Gewohnheit, Bilder einfach mit beliebigen Rahmen zu versehen, ist die Stoffeinfassung
– meistens aus wertvollem Brokat – bei tibetischen Thangkas von symbolischer Bedeutung. Die Einfassung mit ihren klar abgegrenzten Stoffpartien spiegelt die Grundstruktur der tibetischen Kosmologie wider, die Grenzen zwischen Bild und Rahmen fließen ineinander. Bild und Rahmung ergänzen sich somit zu einer symbolischen, aber auch künstlerischen Einheit. Neben dem zentraltibetischen Standardtypus haben sich auch historisch bzw. geographisch bedingte Sonderformen entwickelt. (Lavizzari-Raeber, 1984, S. 240f.)

Stilgeschichte
Der Tibetologe Guiseppe Tucci schreibt: „Tibetan painting reproduces the Tibetan soul like a mirror in which we can discern what this people have learnt from India, China or Central Asia and what they have created on their own initiative.“
Tibet war über viele Jahrhunderte ein sehr abgegrenztes und schwierig zu bereisendes Land, so erklärt sich, dass erst in letzter Zeit Tibet als Forschungsschwerpunkt greifbarer wurde. Die chronologische Entwicklung der Stile lässt sich mittlerweile jedoch ziemlich anschaulich beschreiben. In der nächsten Ausgabe von Buddhismus Heute könnt ihr dann mehr darüber lesen.
Quelle : www.buddhismus-heute.de